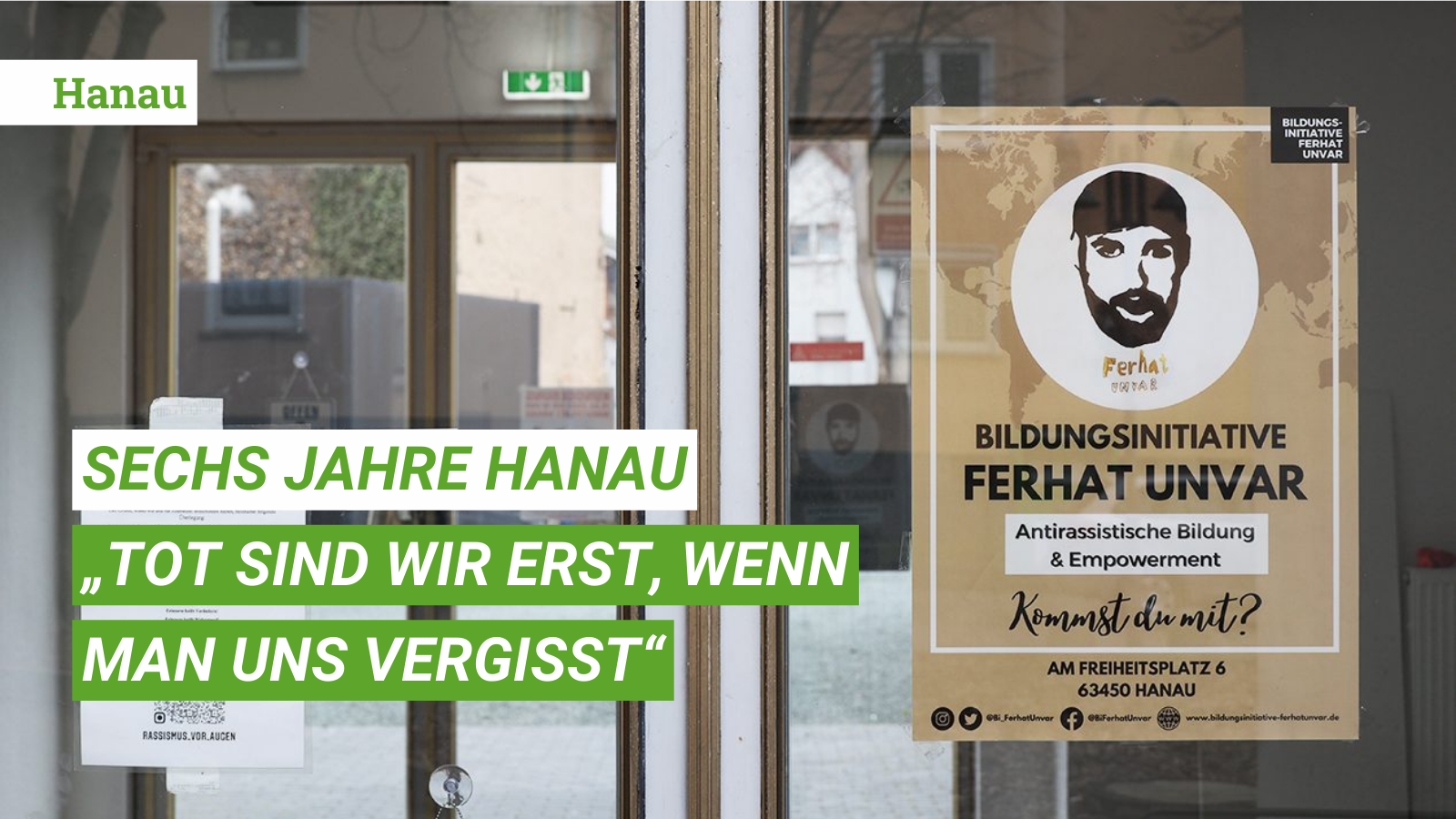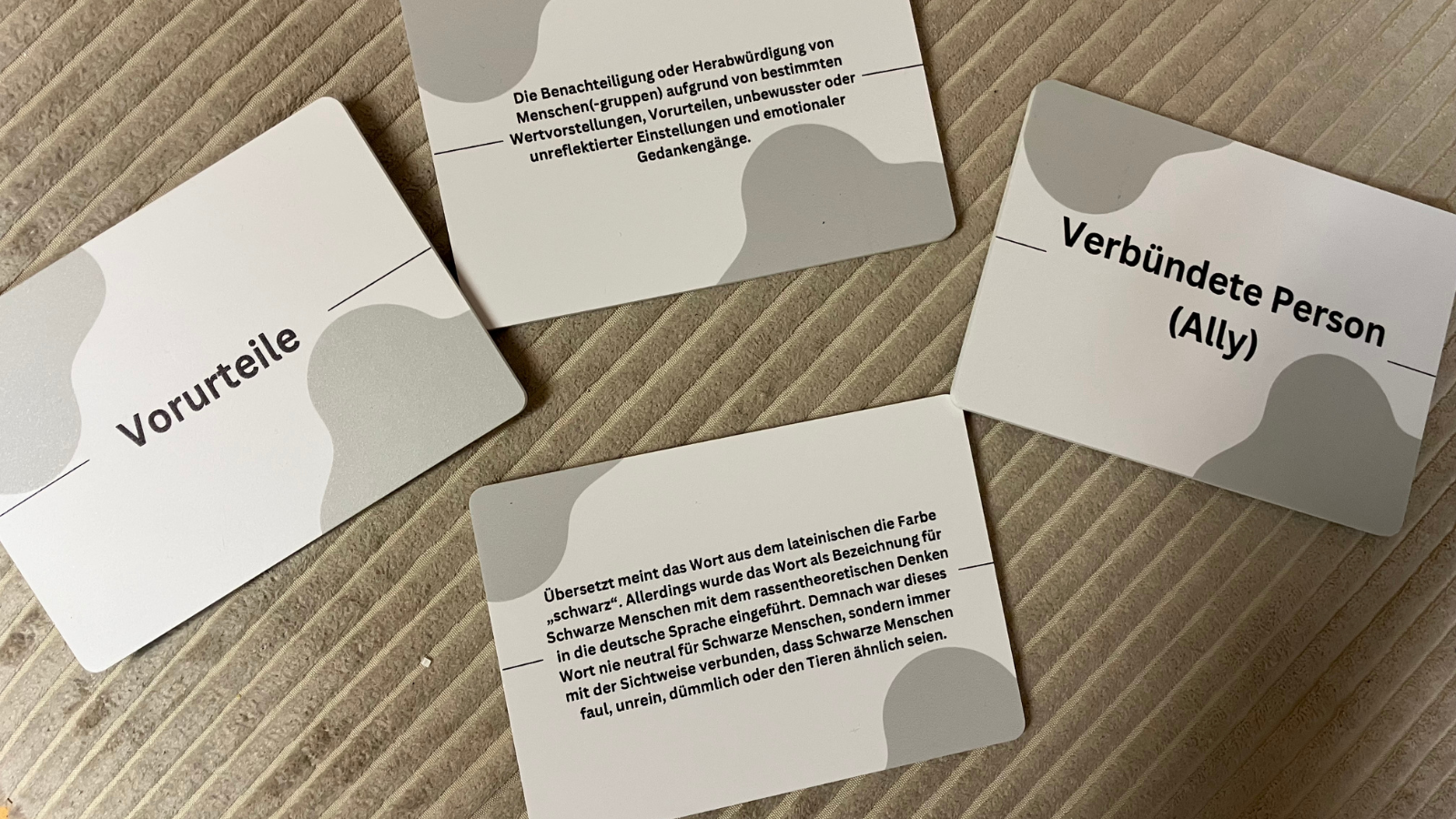Sie werden mit Rassismus nicht nur im Alltag, sondern auch in ihren eigenen Familien konfrontiert. Transnational adoptierte Menschen machen häufig diese Erfahrung und kämpfen zudem mit Identitätskonflikten. Ein von der Amadeu Antonio Stiftung geförderter Workshop des Korea-Verbandes nimmt sich genau dieser Thematik an.
Der Workshop „Roots & Reclamation“ soll Menschen, die aus Korea nach Deutschland adoptiert wurden, einen Safe Space bieten. Menschen, mit ähnlichem Background aber unterschiedlicher Geschichte, treffen hier aufeinander. Eine gemeinsame Suche, nach den eigenen Wurzeln, nach sich selbst. „Das Thema der Zugehörigkeit und der kulturellen Identität war auch für mich lange ein Problem“, erklärt die Workshopleiterin Sun Mee, die selbst eine Adoptionsgeschichte aus Korea hat und nun Workshops für adoptierte Menschen anbietet.
Das zentrale Thema des Workshops ist die Identitätsfindung. Denn die Teilnehmenden, alle selbst mit einer transnationalen Adoptionsgeschichte von Korea nach Deutschland, werden hier häufig als Koreaner*innen wahrgenommen, von Koreaner*innen allerdings als Deutsche. So entsteht bei vielen eine Identitätskrise: Wer sind sie eigentlich?
Der Workshop eröffnet einen Raum, offen über die eigene Adoptions-Geschichte zu sprechen, Fragen zur eigenen Identität zu äußern und sich gegenseitig zu unterstützen. Sich auf Augenhöhe austauschen, das ist der Leiterin Sun Mee wichtig. Respekt, Offenheit, und Neugier sind dabei von zentraler Bedeutung.
Wie der Name des Workshops bereits verrät: Es geht nicht nur um die Wurzeln, sondern auch um “Reclamation”, sich behaupten, etwas zurückgewinnen. Was heißt das? Gerade Fragen rund um Aneignung der Kultur des Landes, in dem man geboren wurde, brennen den Teilnehmer*innen unter den Nägeln. In ausführlichen Diskussionen geht es darum, welche Zwänge es aus dem Umfeld gibt, sich mit dieser oder jener Kultur zu identifizieren. Sun Mee ist daher sehr bedacht, eine positive Atmosphäre zu schaffen: „Vertrauen untereinander aufzubauen und sich von gesellschaftlichen Zwängen und Erwartungen zu befreien, ist mir besonders wichtig”.

Unter den Teilnehmenden kamen manche mit Angst in den Workshop, wie Sun Mee im Interview erzählt. „Das Thema geht mit viel Trauer über den Verlust der ursprünglichen Kultur und Angst vor der eigenen Gefühlswelt einher. Das Gefühl, nicht verstanden zu werden, ist bei vielen präsent“. Diese Angst legt sich aber schnell, wie sie weiter erzählt. Die Teilnehmenden sind ganz überrascht, dass trotz der Schwere des Themas so viel gelacht werden kann.
Für die Leiterin Sun Mee ist es wichtig, dass die Teilnehmenden Strategien finden, um mit der eigenen vielschichtigen Identität umzugehen: „Wie kann ich diese herausfordernden Gefühle ummünzen in Empowerment? Stolz zu sein in einer Zwischenwelt, die auch viel Freiheit bietet. Niemand sagt uns hier, wie wir uns verhalten müssen“, erklärt Sun Mee begeistert. Wie man im Alltag diesem Thema mit Selbstbewusstsein begegnen und einen äußeren Druck wegnehmen kann, sind zentrale Fragen der Diskussionen.
“Die Suche nach Identität ist auch immer eine Suche nach dem eigenen Selbstwert”, betont Sun Mee “Denn je mehr ich in mir selbst verankert bin, desto besser kann ich mich auch gegen rassistische Äußerungen, Angriffe oder Stigmata wehren.”