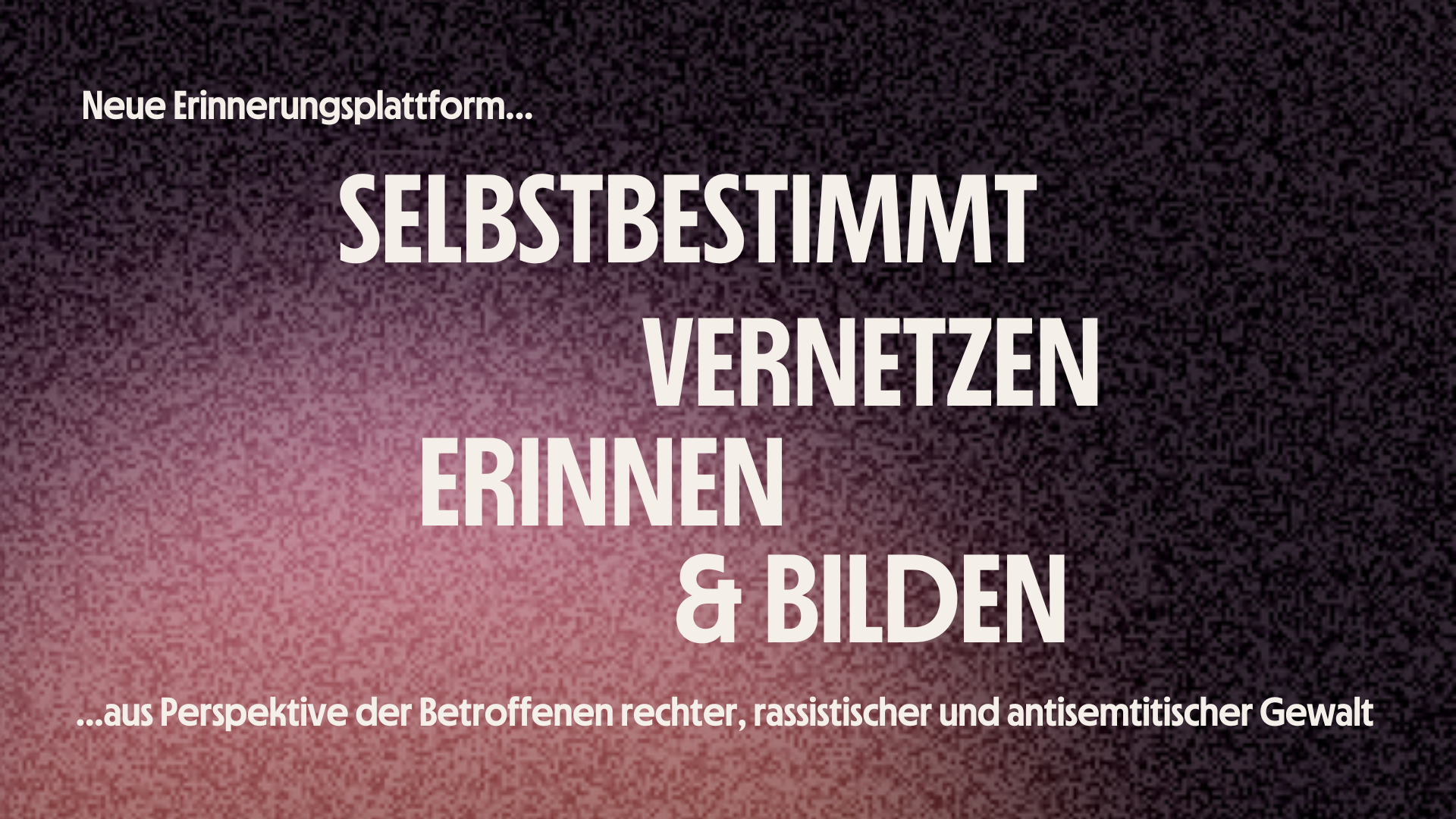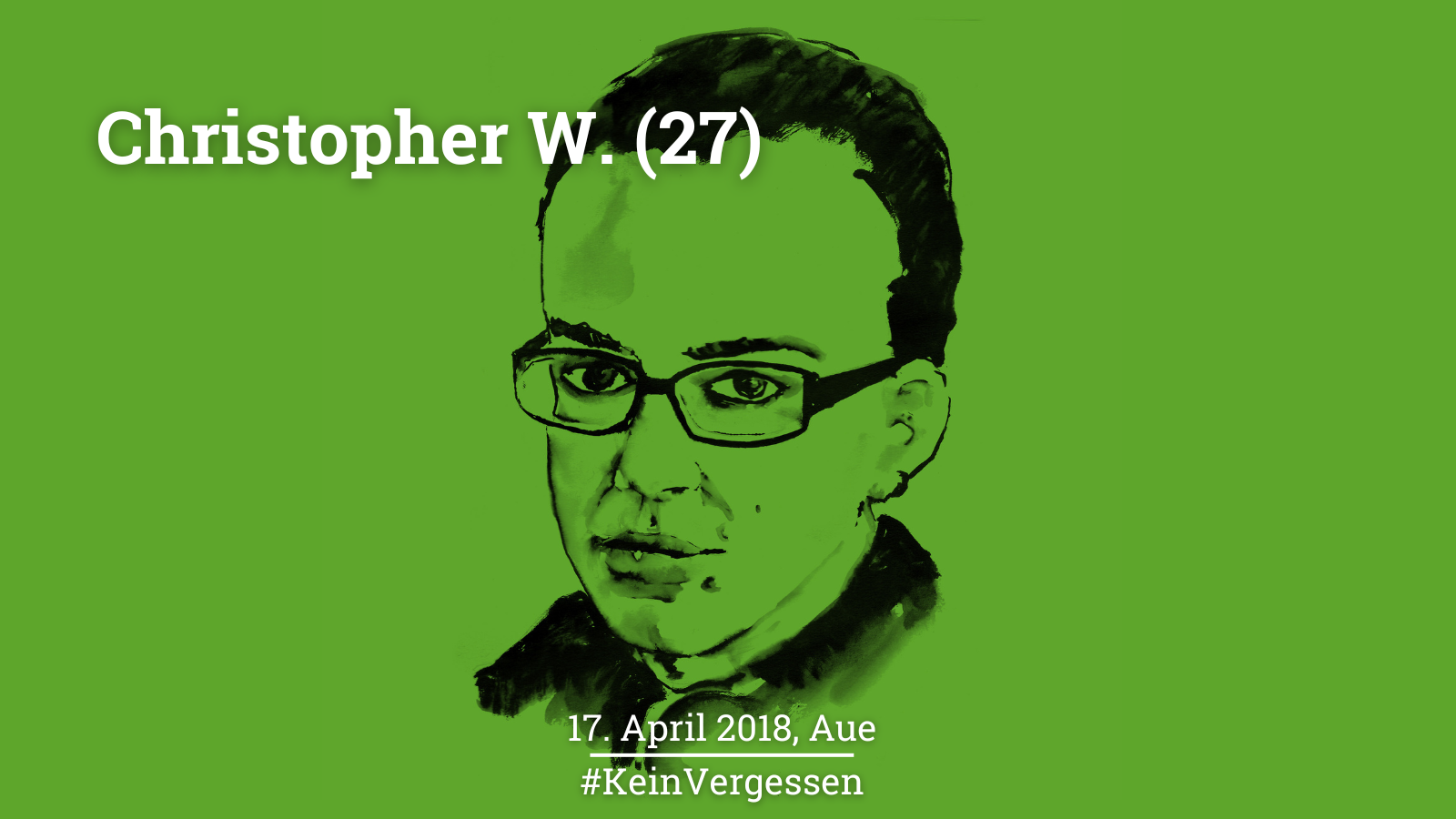Die Ausstellung „Braune Geschichtslügen aus Tübingen. Die Grabert Verlage“ der Geschichtswerkstatt Tübingen e.V. widmet sich einem Verlagshaus, in dem seit mehr als 50 Jahren Literatur für Neonazis publiziert wird. Die Amadeu Antonio Stiftung unterstützt den Verein bei der Aufklärung.
Der „Grabert-Verlag“ ist seit über 50 Jahren eines der bekanntesten und erfolgreichsten Verlagshäuser, welches Neonazis mit revisionistischer und antisemitischer Literatur versorgt. Immer wieder hat der Verlag mit Gerichtsverfahren und Indizierungen zu kämpfen und bietet trotzdem noch heute einschlägigem Geschichtsrevisionismus eine Plattform. Seinen Ursprung hat der Verlag in völkischem Nationalismus, Heidentum und Antisemitismus. Eine Tradition, die mit dem Verlagsgründer Herbert Grabert begann.
Grabert studierte in den 20er Jahren Theologie und Religionswissenschaft. Schon als junger Mann war er in einem rechtsgerichteten Freikorps und im „Bund der Köngener“ aktiv. Letzterer war eine jugendliche liberal-theologische Reformbewegung mit teils völkischen Ideologieelementen. Später ging der Bund, in dem Grabert lange Jahre als Schriftleiter und Autor arbeitete, in der nationalsozialistischen „Deutschen Glaubensbewegung“ auf, die das Christentum aufgrund seiner auch jüdischen Wurzeln durch eine heidnische Religion abzulösen versuchte. Grabert trat 1939 in die NSDAP ein und strebte eine Karriere als völkischer Religionswissenschaftler an, konnte damit jedoch nie langfristig in Universitäten Fuß fassen.
Nationalsozialisten inszeniert als „Entrechtete“
Nach Kriegsende wurde Grabert zwar die Lehrberechtigung zugestanden, doch eine universitäre Anstellung konnte er nicht mehr erlangen. Aufgrund der daraus entstehenden finanziellen Notlage sah sich Grabert zunehmend als „Entrechteter“ und begann 1950 mit der Gründung des „Verbands der nicht-amtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer“, weitere durch die Entnazifizierung entlassene Dozierende zu vereinen. Der Verband finanzierte Veröffentlichungen und versuchte die Wiedereinstellung der Entlassenen durchzusetzen. 1953 wurde der „Verlag der deutschen Hochschullehrer-Zeitung“ als Plattform und Vertriebsorgan für die Publikationen Graberts und seiner Gesinnungsfreunde. Als Mitte der 1950er Jahre ein großer Teil der Dozierenden wieder eine Anstellung erhielt, wandte Grabert sich in seinen Publikationen mehr und mehr aktuellen Themen wie beispielsweise der Bevölkerungspolitik zu – um gleichzeitig immer auf Theorien und Ideologie des Nationalsozialismus zurückzugreifen.
1961 gelang Grabert mit dem Buch „Der erzwungene Krieg“ des amerikanischen revisionistischen Historikers David L. Hoggan im Jahr 1961 der erste großen kommerzielle Erfolg seines Verlages. Hoggan bestritt in seinem Buch die Schuld Deutschlands am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Das Buch war das erste in der Reihe des Grabert eigenen „Instituts für deutsche Nachkriegsgeschichte“ und markiert die Wende zum einschlägig revisionistischen Verlag. Nach der Übernahme der Vertragsleitung durch Graberts Sohn Wigbert wandte sich dieser zunehmend auch neuheidnischen Themen und dem Germanentum zu.
Revisionismus im „Dienste der Wahrheit“
Im 1974 zum „Grabert-Verlag“ umbenannten Verlag wurden Werke mehrerer Personen verlegt, die im Dritten Reich hohe Positionen innehatten. Aber auch heute sehen sich die Grabert-Verlagsgruppe und ihre Autoren „im Dienste der Wahrheit“ und verbreiten ein revisionistisches Geschichtsbild. Geprägt von Antisemitismus, völkischem Nationalismus und Holocaustleugnung, bedienen sie damit ihre rassistische und neonazistische Klientel. Juristische Auseinandersetzungen über seine Publikationen begleiteten die gesamte Geschichte des Grabert-Verlagskomplexes. Bücher wurden nach Jugendschutzvorschriften indiziert, sie wurden eingezogen und beschlagnahmt. Verleger und Autoren wurden vor Gericht gestellt, wegen Beleidigung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener – und wegen Volksverhetzung. Es gab etliche Verurteilungen, und Herbert und Wigbert Grabert mussten in den letzten Jahrzehnten insgesamt mehrere zehntausend Euro an Geldstrafen bezahlen. Immer wieder ging es um den Vorwurf der Holocaust-Leugnung.
Die Ausstellung der Geschichtswerkstatt Tübingen zeigt an Beispielen wie „Der Auschwitz-Mythos – Legende oder Wirklichkeit? Eine kritische Bestandsaufnahme“ von 1979 oder „Geschichtsbetrachtung als Wagnis“ von 1984, wie historische Wahrheiten von den Autoren verdreht werden. Gleichzeitig wird in die thematischen Komplexe Antisemitismus, Holocaustleugnung und Rassismus eingeführt und die Geschichte der Verlagsgruppe anhand der verlegten Autoren und Werke aufgezeigt. Auch die Einbindung des Grabert-Verlags in neonazistische Netzwerke von Personen und Verlagswesen will die Ausstellung aufzeigen. Die Verlagsgruppe bildet inzwischen eine Verflechtung mehrerer Einrichtungen, darunter das Tochterunternehmen „Hohenrain Verlag“ mit ähnlicher Ausrichtung, ein Versandbuchhandel und die Hoggan-Stiftung, die den Revisionisten, der durch seine Veröffentlichungen in die öffentliche Kritik geriet, finanziell unterstützt.
Tief verwurzelt im braunen Mediennetz
Weil die Grabert-Verlagsgruppe nach wie vor ein wesentliches Publikationsorgan für Geschichtsrevisionisten und Organisationsorgan für die „Neue Rechte“ darstellt, will die Geschichtswerkstatt Tübingen e.V. eine verstärkte öffentliche und kritische Auseinandersetzung mit den Verlagsinhalten initiieren und unterstützen. Die Amadeu Antonio Stiftung fördert die Ausstellung „Braune Geschichtslügen aus Tübingen. Die Grabert Verlage“, weil sie sich einem Verlag widmet, der seit Jahrzehnten unverhohlen Geschichtslügen verbreitet, Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert und Opfer verhöhnt, ohne dass das Problem in der Öffentlichkeit bewusst ist.
Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Dezember 2010 in der Volkshochschule Tübingen zu sehen. Mit Begleitveranstaltungen werden die Geschichte des Hauses untermalt, aber auch aktuelle Tendenzen im Mediennetz zwischen Konservatismus, völkischem Nationalismus und NeonaziSzene vorgestellt.
Von Robert Fähmel