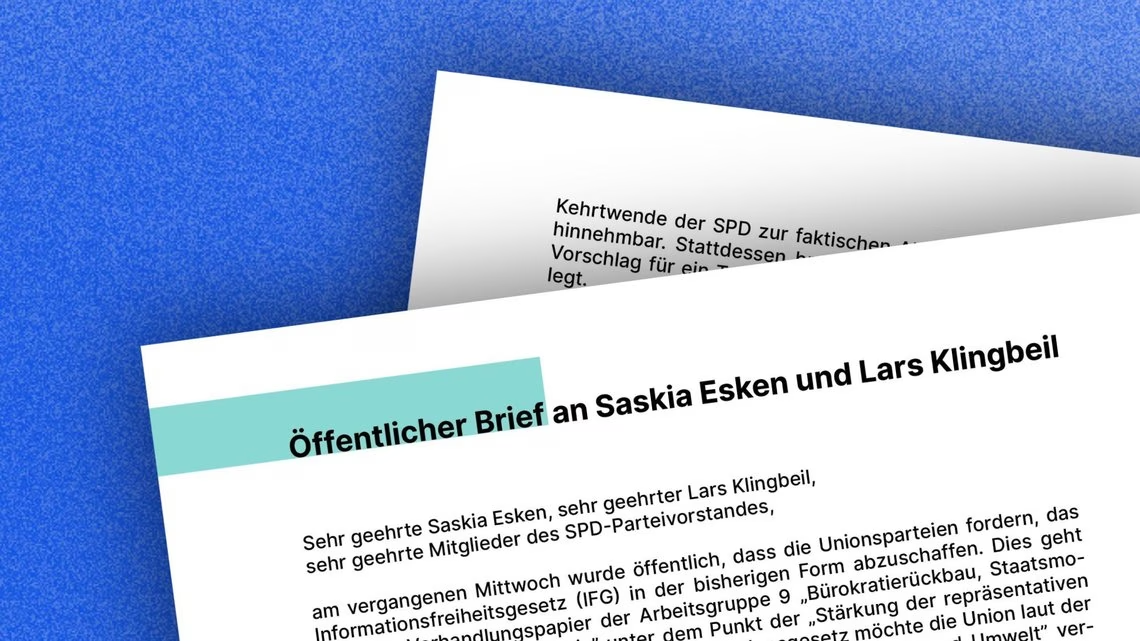Heute vor sechs Jahren wurde das Urteil im NSU-Prozess gefällt. Ein Urteil, auf das die Angehörigen der Opfer wohl eine gefühlte Ewigkeit warten mussten. Für viele Menschen, insbesondere jüngere, ist der NSU-Terror inzwischen zu einem Stück zurückliegender Geschichte geworden, das vermeintlich nichts mehr mit heute zu tun hat. Ein Dokumentationszentrum soll erinnern und die Brücke in die Gegenwart schlagen.
Von Josephine Köhne
Der NSU-Prozess selbst dauerte über fünf Jahre, 438 qualvolle Prozesstage. Doch das Erschreckende ist, dass es erst einmal zwölf Jahre dauerte, bis die deutschen Ermittlungsbehörden dem eigentlichen Übel auf die Schliche kamen – und das allein durch eine Selbstenttarnung der Rechtsterroristen. Jahre, in denen der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) neun Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin ermordete, Sprengstoffanschläge mit mehreren verletzten, teils schwerverletzten, Personen sowie zahlreiche Banküberfälle verübte. Und der größte Skandal: Die rassistische Mordserie wurde jahrelang als Taten innerhalb eines Milieus der organisierten Kriminalität verklärt und mit rassistischer Zuschreibung als „Dönermorde“ abgestempelt.
Als der NSU 2011 aufflog, töteten sich zwei des vermeintlichen Kern-Trios, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, selbst. Die dritte im Bunde, Beate Zschäpe, stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Am 11.07.2018 wurde Beate Zschäpe als Hauptangeklagte des zehnfachen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Vier weitere Unterstützern wurden als Mitangeklagte zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren verurteilt. Einige Opfervertreter sind mit dem Urteil nicht einverstanden. Denn noch heute sind viele Fragen ungeklärt, was insbesondere die Angehörigen der NSU-Opfer kritisieren. Sie bemängeln die Aufklärung zu den Hintergründen der Morde, zur Rolle des Verfassungsschutzes im Gesamtkomplex sowie zur Frage, ob es wirklich nur drei Haupttäter*innen waren, die maßgeblich an den Morden beteiligt waren. Während eine Vielzahl von Nebenanklageanwälten anzweifelte, dass es sich nur um drei Täter*innen handelte, schloss die Bundesanwaltschaft die These eines strukturierten Netzwerkes bereits vor Beginn des Prozesses aus, trotz der vielen Hinweise auf eine größere Anzahl an Mittäterschaft.
Die lückenhafte Beantwortung der Fragen lässt die Angehörigen der Opfer noch heute rastlos zurück. Über teils zwei Jahrzehnte kämpften sie für eine adäquate Ermittlung und Aufarbeitung der rassistisch motivierten Gewalttaten. Durch die zuerst nicht vorhandene und später unzureichende Ermittlungsarbeit der deutschen Behörden im Kontext NSU haben sich eigeninitiativ, vor allem durch die Angehörigen der Opfer, Netzwerke gebildet, die maßgeblich zur Aufklärung der NSU-Morde beitragen.
Ein NSU-Dokumentationszentrum als Beitrag zur Aufarbeitung
Nicht nur das strukturelle Versagen der Justiz wirkt noch bis heute nach. Auch die erinnerungspolitische Verantwortung des deutschen Staates ist mehr als ungenügend. Doch das soll sich nun ändern: In ihrem Koalitionsvertrag von 2021 legte die Bundesregierung fest, ein bundesweites NSU-Dokumentationszentrum zu errichten. Im Februar dieses Jahres erschien dazu eine Machbarkeitsstudie, durchgeführt von der Bundeszentrale für Politische Bildung. Über die genaue Ausgestaltung ist bisher noch nicht viel bekannt. Der Bund folgt damit einem Pilotprojekt aus Sachsen, welches als Interim-Standort voraussichtlich in das bundesweite Vorhaben integriert werden soll. Die sächsische Landesregierung hat sich bereits 2019 auf ein NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz geeinigt. Im nächsten Jahr soll es eröffnet werden.
Dieses Pilotprojekt basiert auf der zugrundeliegenden Machbarkeitsstudie der Vereine ASA-FF e.V. und RAA Sachsen aus dem Jahr 2023, die die Amadeu Antonio Stiftung gefördert hat. Das Dokumentationszentrum entsteht aus der Zusammenarbeit beider Vereine und der Initiative Offene Gesellschaft e.V. und wird finanziell durch das Land Sachsen und dem Bund gefördert. Das Pilotprojekt soll in Chemnitz im früheren Stadtwerke-Haus eröffnet werden. Der Ort ist umstritten. Wie die taz berichtet, empfinden einige Betroffene Chemnitz als “Täterstadt” für zu gefährlich und plädieren für Berlin. Das könnte womöglich durch das bundesweite Vorhaben realisiert werden. Doch Interviews, die der ASA-FF e.V. mit Angehörigen der Opfer und Überlebenden des NSU-Komplexes führte, geben anderes her. Daher appellierte der Verein an die Stadt Chemnitz, einen Ort der Erinnerung zu bauen. Auch Gamze Kubaşık, die Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Mehmet Kubaşık, forderte die Stadt Chemnitz auf, ihrer Verantwortung entgegenzutreten: „Es muss einen Raum geben, in dem das Recht auf Wahrheit und Aufklärung gegeben ist – etwas das mir und meiner Familie jahrelang verwehrt wurde.” Warum Chemnitz? Der NSU konnte dort jahrelang unentdeckt agieren und es ist der einzige Ort mit NSU-Bezug, an dem bislang ein Erinnerungsort fehlt.
Gedenken und pädagogische Auseinandersetzung mit Rassismus an einem Ort
Das Dokumentationszentrum in Sachsen könnte ein Meilenstein der Erinnerungskultur rechtsextremen Terrors werden. In enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen sollen deren Bedürfnisse in den Aufarbeitungsprozess dauerhaft mit einfließen. Deshalb werden sie in die Entscheidungsgremien des Dokumentationszentrums mit eingebunden. Um den Fokus nun endlich auf die Betroffenenperspektive zu lenken, werden unter anderem die Proteste der Angehörigen unter dem Titel „Kein 10. Opfer“ aus dem Jahr 2006 als Videos gezeigt. Damit machten die Angehörigen schon damals auf den rassistischen Kern der Morde aufmerksam, lange bevor die Mehrheitsgesellschaft die Taten in den Zusammenhang einer rassistischen Mordserie brachte.
Außerdem soll es einen geschützten Begegnungsraum für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt geben. Um den Bogen in die Gegenwart zu spannen, werden neben Ausstellungen und Dokumentationen zum NSU auch bildungspädagogische Angebote realisiert, mit dem Ziel die Handlungssicherheit gegenüber Rassismus in der Gesellschaft zu stärken. Die Projektleitung Lydia Lierke bringt die Bedeutung des Projektes auf den Punkt: „11 Jahre nach dem Beginn des NSU-Prozesses wissen viele junge Menschen bereits nichts mehr darüber. Die Opfer des NSU dürfen nicht vergessen werden. Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, es darf kein Schlussstrich gezogen werden.“