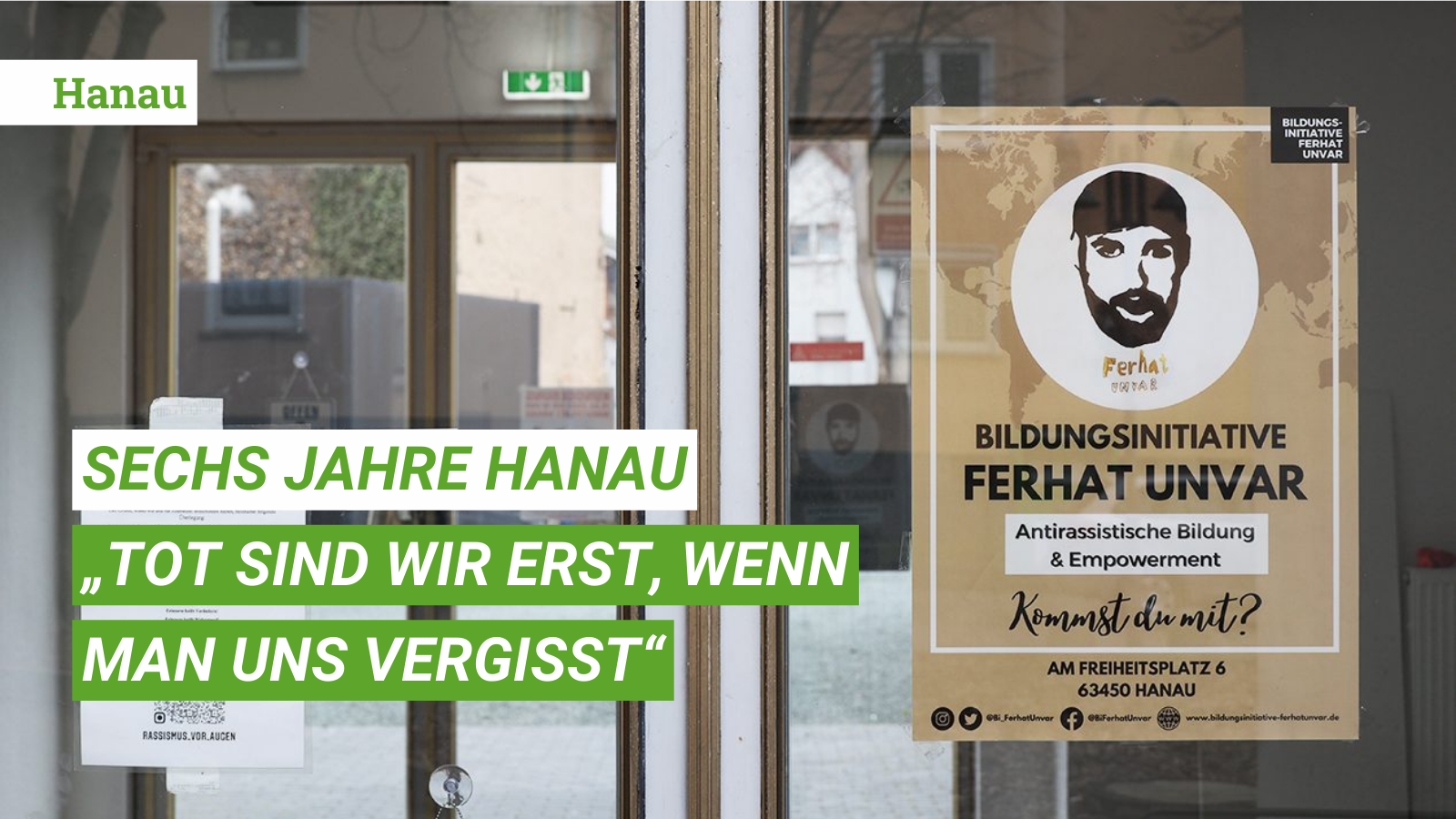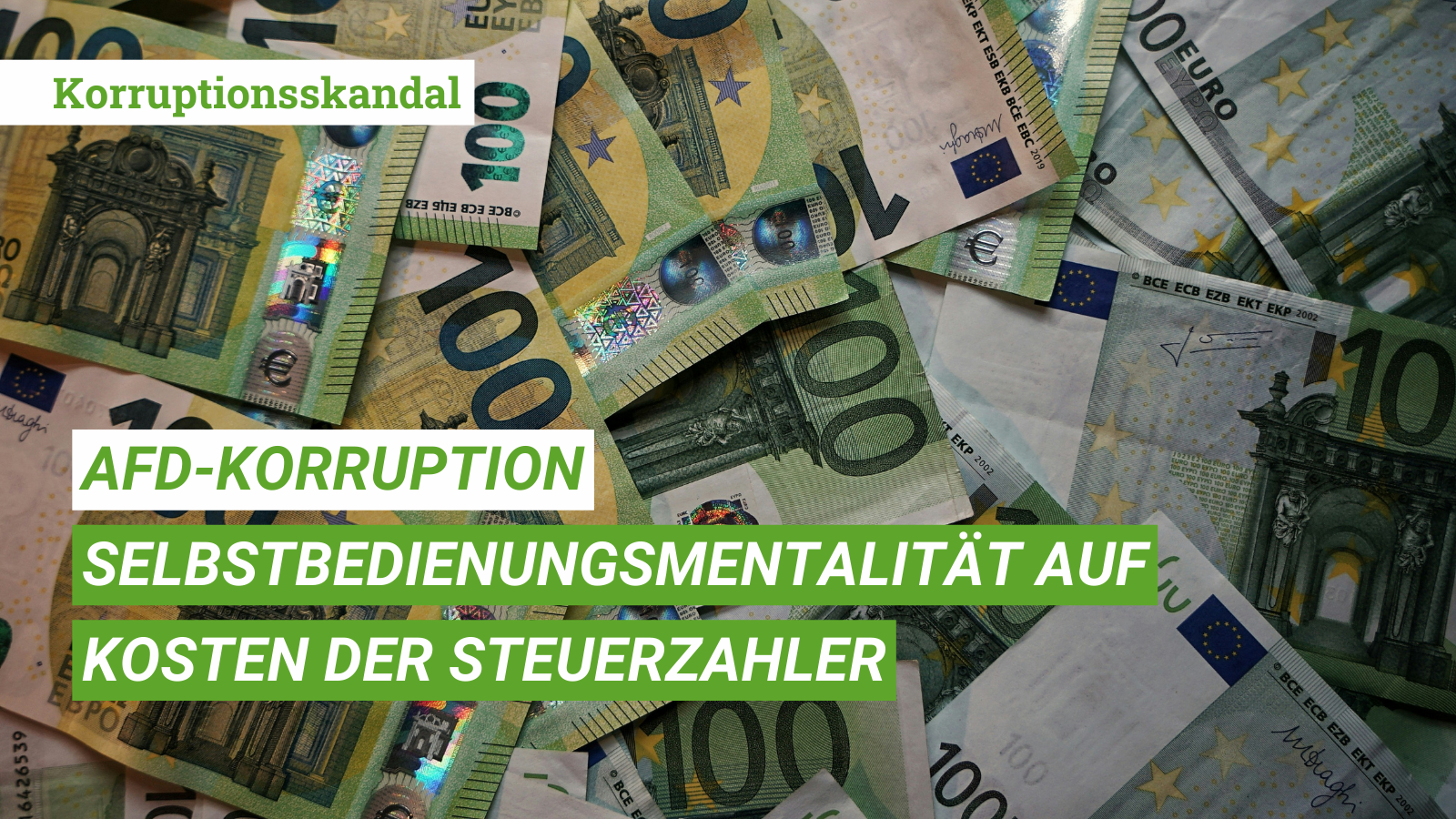Seit diesem Frühjahr fand am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter des Sprengstoffanschlags am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn statt. Damals – im Juli 2000 – verlor eine Frau ihr ungeborenes Baby, sechs der Opfer wären jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Am 31. Juli wurde der Angeklagte aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wie kam es dazu, dass der Prozess nach fast 18 Jahren stattfand? Und wie lief dieser ab, warum wurde Ralf S. freigesprochen?
Von Jonas Vetter
Unterstützt durch die Amadeu Antonio Stiftung hat die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus NRW den Prozess beobachtet. Ausschlaggebend für das Projekt ist ein Anachronismus der Strafprozessordnung: Es gibt in solchen Prozessen kein offizielles (Wort)Protokoll. Die Beobachtung ermöglicht, sowohl während als auch nach dem Verfahren nachvollziehen zu können, was im Gerichtssaal gesagt wird bzw. wurde. Ohne die Protokolle von NSU-Watch und der Süddeutschen Zeitung wüssten wir nicht, was im NSU-Prozess gesagt wurde. Ohne die Beobachtung der RAA Sachsen wären die Taten der „Gruppe Freital“ nicht so detailliert ausgeleuchtet. So saß auch im Prozess am Düsseldorfer Landgericht an jedem Verhandlungstag mindestens eine Person der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Zuschauerraum, um zu protokollieren, was im Prozess gesagt wurde.
Denn Grundlage von Urteilen sind stets die – nicht öffentlichen – Aufzeichnungen der Richter*innen. Die Prozessbeobachtung ist auch bei einer möglichen Wiederaufnahme wertvoll, denn dadurch werden Urteile überprüfbarer. Auch im Fall Wehrhahn ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger haben Revision eingelegt.
Auch die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Düsseldorf kann noch nicht sagen, wie erfolgreich diese sein wird. Denn trotz der 178.000 Seiten füllenden Ermittlungsakte und mehreren Zeugenaussagen, die Ralf S. belasten, gibt es keine konkreten Beweise, sondern nur Indizien – das Kernproblem des Prozess.
Kurz nach der Tat geriet Ralf S. schon einmal ins Visier der Polizei, als dringend tatverdächtig festgenommen wurde er jedoch erst am 1. Februar 2017. Der Grund: Als Ralf S. wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in der JVA Castrop-Rauxel einsaß, habe er einem Mithäftling von der Tat berichtet. Jedoch wurde diesem (und weiteren) Zeugen aufgrund der ausgeprägten Angeberei von Ralf S. nicht geglaubt. Zu Beginn ging Staatsanwalt Ralf Herrenbrück noch sicher von einem Schuldspruch aus. Doch Richter Rainer Drees machte bald deutlich, dass er dem so nicht folgen würde. So wurden Drees Fragen bei der Zeugenbefragung zunehmend eindringlicher. Dies tat er jedoch in einer Art, welche die Zeug*innen verunsicherte und sie ihre Antworten relativieren ließ. Das letzte Drittel des Prozesses war für die Beobachtenden besonders bemerkenswert. Es begann am 17. Mai 2018 mit der Entlassung von Ralf S. aus der Untersuchungshaft. Später meldete sich ein weiterer Zeuge, dem S. ebenfalls von seiner Tat berichtet haben soll. Aber auch diesem Zeugen glaubte das Gericht nicht. Besonders brisant sind die in diesem Zeitraum bekannt gewordenen Absichten des mutmaßlichen Täters, Oberstaatsanwalt Herrenbrück zu töten. Für das Gericht bloß ein weiterer Beleg für die Prahlerei von S. Für die Polizei jedoch durchaus Grund von einer ernsthaften Gefährdung Herrenbrücks auszugehen. Sie stellte ihn unter Polizeischutz. Auch die Verteidigung von Ralf S. fiel auf: Hülya Karaman, Anwältin der Verteidigung, verfolgte eine aggressive Strategie, die in einer fast schon höhnischen Befragung der früheren Opfer mündete. Weitere Unregelmäßigkeiten sieht die Mobile Beratung in der Art, wie mit der Bundeswehrvergangenheit von Ralf S. umgegangen wurde. Unter anderem soll der bekannte Neonazi die geladenen Zeugen vor dem Prozess kontaktiert haben.
Alles sprach für den Schuldspruch. Für die Mobile Beratung ist das Urteil schwer zu ertragen: „Wenn es nicht Ralf S. war, muss es ein professioneller Doppelgänger gewesen sein“. Es bleibt also abzuwarten, was eine mögliche Revision des Verfahrens bringen wird.