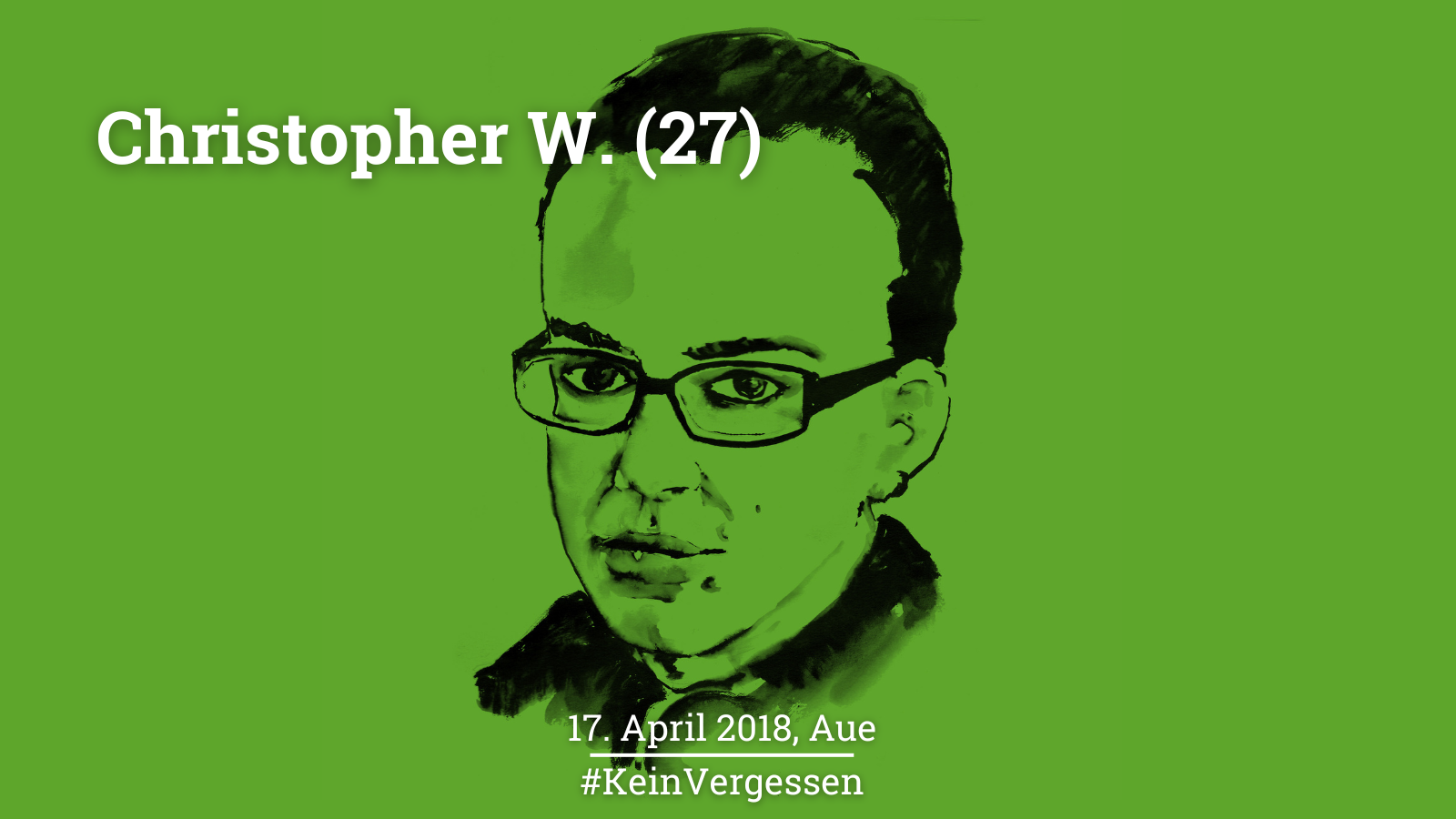“10 Jahre Selbstenttarnung des ‚NSU‘ – Wo stehen wir heute im Umgang mit rechter Gewalt?“ – Am 3. November sprachen Betroffene von rechter Gewalt und rechtem Terror auf einer Tagung des Opferfonds CURA über ihre Erfahrungen. Gemeinsam mit Vertreter*innen aus Ermittlungsbehörden und Justiz wurde eine Bilanz der Berliner Landespolitik gegen Hasskriminalität, Rechtsextremismus und Diskriminierung gezogen.
von Bela Mittelstädt
10 Jahre nach der Selbstenttarnung des Kerntrios des sogenannten ‚NSU’– 10 Jahre nach dem Ende einer rechtsextremen Mordserie, der mindestens 10 Menschen zum Opfer fielen, sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung an. Sind nach dem Auffliegen des ‚NSU‘-Komplexes mit seiner erschreckenden staatlichen Mitverantwortung also Konsequenzen gezogen worden? Und ist die Gefahr durch Rechtsterrorismus und rechte Gewalt endlich auch in den Köpfen von Politik und Sicherheitsbehörden angekommen? – Das Urteil des Abschlusspodiums der Konferenz des Opferfonds CURA fiel vernichtend aus.
Mehmet O., Überlebender eines Anschlags des ‚NSU‘ im Jahr 1999, Abdulkerim Şimşek, Sohn des Ermordeten Enver Şimşek, Christina Feist, Überlebende des Anschlags von Halle und Armin Kurtović, Vater des in Hanau getöteten Hamza Kurtović beschrieben bewegend und unmissverständlich, was der Umgang der Behörden nach den Taten mit ihnen und ihren Angehörigen gemacht hatte. Erfahrungen, die einen Zeitraum von über 20 Jahren abdecken. Abdulkerim Şimşek erzählte von den entwürdigenden Umgang mit seiner Familie und den rassistischen Verdächtigungen. Als Hauptverdächtige galten ohne Anhaltspunkte die Mutter und der Bruder. Dies habe sich auch nach der Aufdeckung des ‚NSU‘ kaum geändert: “Warum musste ich aus dem Radio hören, dass mein Vater ein Opfer des NSU ist?”. Rassistische sowie antisemitische Vorurteile, Ignoranz und falsche Versprechungen hatten sie alle erlebt. So fällt ihre Bewertung der Fehlerkultur insbesondere der Polizei weiter erschreckend negativ aus. Hier müsse viel Vertrauen wieder hergestellt werden.

Die Konferenz unter dem Titel “10 Jahre Selbstenttarnung des ‚NSU‘ – Wo stehen wir heute im Umgang mit rechter Gewalt?“ nutzte den Anlass des Jahrestages auch dazu, um einen besonderen Blick auf die Situation in Berlin zu werfen und gemeinsam mit Betroffenenvertreter*innen und Vertreter*innen aus Ermittlungsbehörden und Justiz eine Bilanz der Landespolitik gegen Hasskriminalität, Rechtsextremismus und Diskriminierung zu ziehen. Hier zeigte sich unter anderem, dass sich die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Hasskriminalität für viele Beteiligte bewährt hat.
Die Berichte der Betroffenen von Diskriminierungen durch Polizeieinsätze und Fehlerkultur der Behörden offenbarte jedoch weiterhin große Missstände: Jeff Kwasi Klein vom Antidiskriminierungsprojekt Each One Teach One e.V und Vertreter*innen der Sinti*ze und Rom*nja kritisierten ein geringes Problembewusstsein und mangelnde Fehlerkultur der Polizeibehörden. Racial Profiling und rassistische Behandlung durch die Behörden seien für Schwarze sowie Sinti*ze und Rom*nja an der Tagesordnung. “Für Sinti und Roma in Deutschland ist die Polizei leider keine vertrauensvolle Institution”, fasste Anja Reuss vom Zentralrat deutscher Sinti und Roma zusammen. Der strukturelle und institutionelle Rassismus in den Sicherheitsbehörden besteht also weiter. Feste Ansprechpartner*innen gegen Rassismus und Antiziganismus sind hier ein erster Schritt, langfristig müsse jedoch vor allem ein Mentalitätswandel zu mehr Fehlerkultur und Problembewusstsein her.
Betroffene von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt erfahren häufig nicht nur Ignoranz, sondern werden gar als eigentliche Täter*innen verdächtigt oder verantwortlich gemacht. Die Folgen dieser sekundären Viktimisierung untersucht Daniel Geschke vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, der auch die traumatisierende Wirkung herausstellte.
Neben den Betroffenenvertreter*innen schilderten auch Aktivist*innen und Kommunalpolitiker*innen eindrücklich ihre Bedrohungslage in Berlin. Die rechte Anschlagsserie in Berlin Neukölln zeige exemplarisch, wie Bedrohungen permanent zunehmen, während das Vertrauen in die Behörden kontinuierlich sinkt.

Das Urteil über den Umgang von Staat und Behörden mit den Opfern von Rechtsterrorismus nach dem ‚NSU‘ ist mindestens enttäuschend. Eines habe sich nach dem ‚NSU‘ jedoch geändert, sagen die Teilnehmenden des Abschlusspodiums. Es werde offen über Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit und Rechtsterrorismus gesprochen. Es gäbe einen Teil der Gesellschaft, der den Betroffenen inzwischen zuhöre. Politische Konsequenzen oder Problembewusstsein scheint es an den entscheidenden Stellen jedoch bisher kaum zu geben. Horst Seehofer sieht zum zehnten Jahrestag, im ‚NSU‘-Komplex alle notwendigen Reformen umgesetzt. Eine Bewertung, die auf dieser Konferenz auf wenig Zustimmung von den Betroffenen treffen dürfte.

Hier finden Sie Ankündigung und Programm der Veranstaltung.